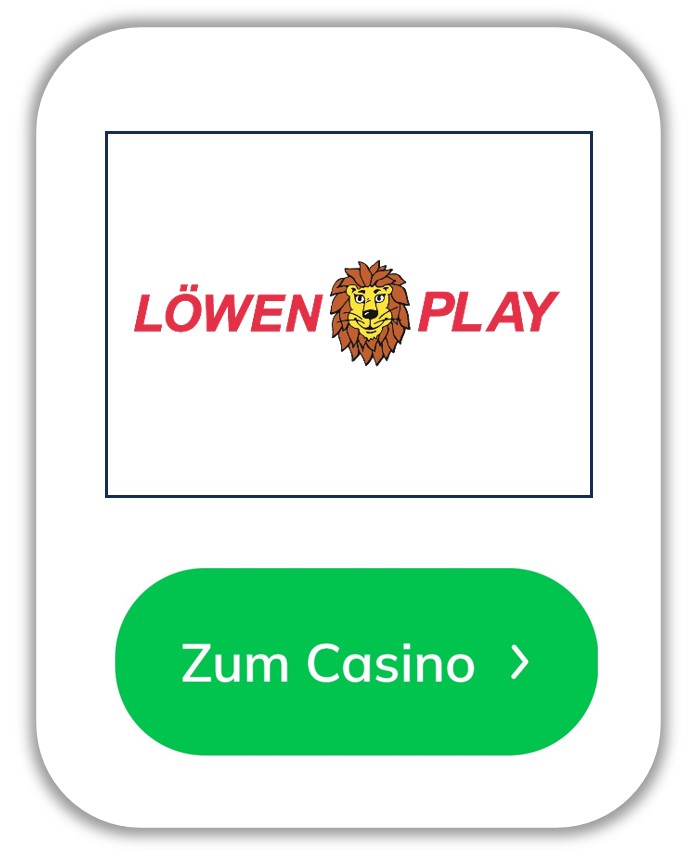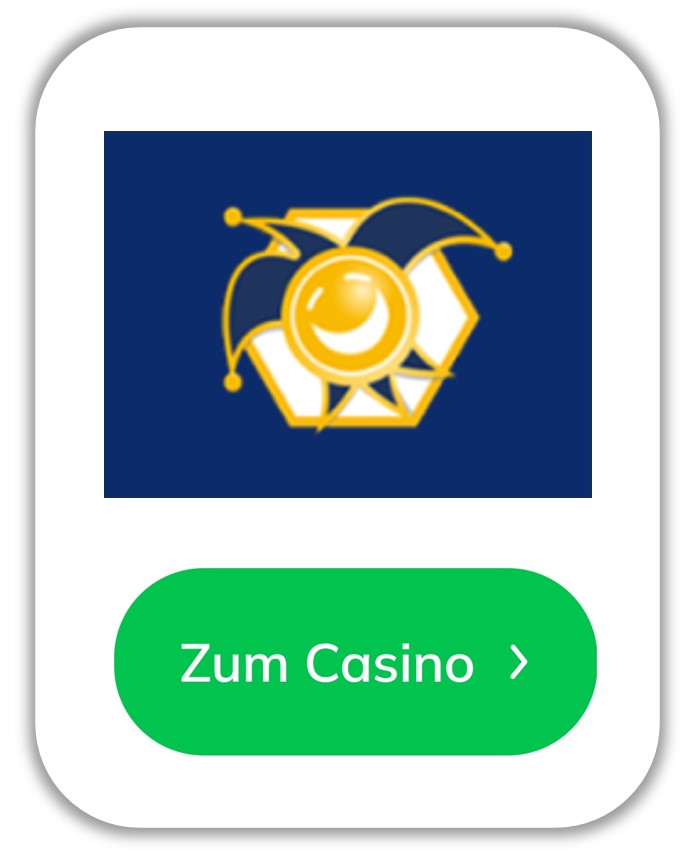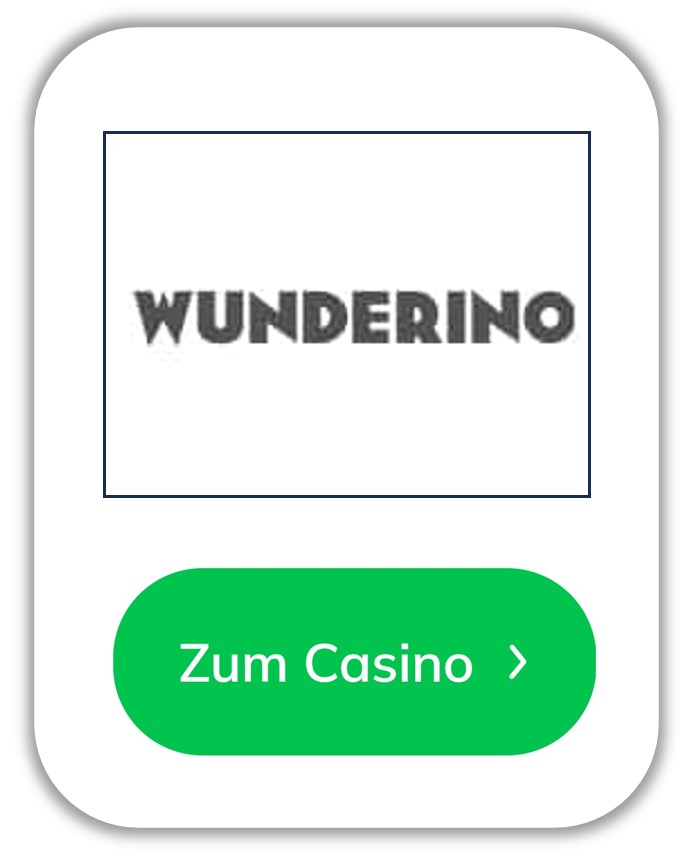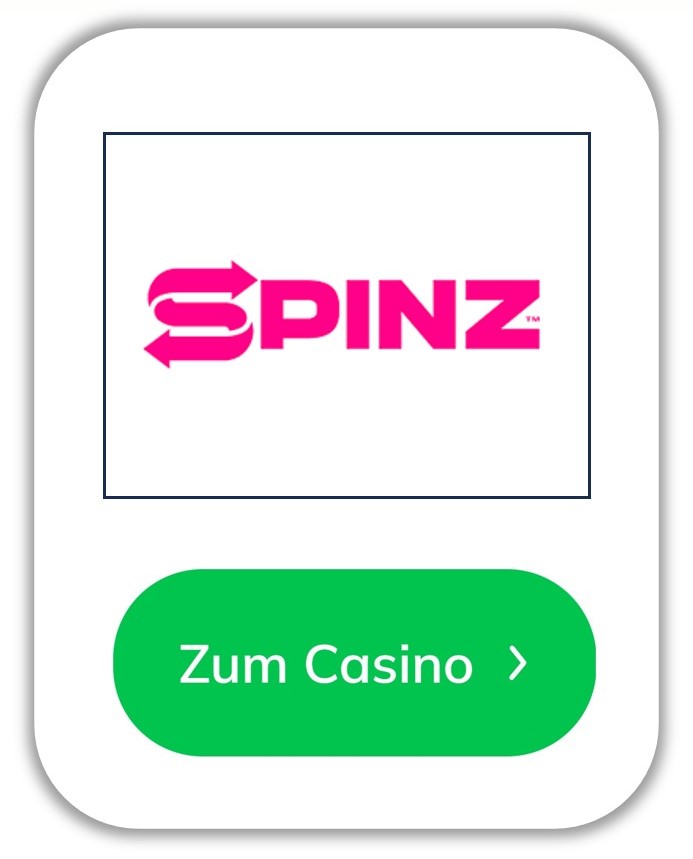Tipico soll Verluste zurückzahlen – trotz maltesischer Lizenz

Der maltesisch lizenzierte Anbieter Tipico wurde verpflichtet, die Verluste eines deutschen Spielers zwischen 2013 und 2020 in vollem Umfang zurückzuzahlen.
Entscheiden deutsche Gerichte zunehmend im Sinne der Spieler? Der nun bekannt gewordene Beschluss des Oberlandesgerichts Stuttgart vom 25. April 2025 deutet in diese Richtung.
Der Fall in Kürze
Ein Kläger hatte über Jahre hinweg an den Casino-Angeboten von Tipico teilgenommen und dabei erhebliche Summen verloren. Tipico soll die Verluste nun zurückzahlen. Das OLG Stuttgart bestätigte das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts Stuttgart und ließ die Revision zum Bundesgerichtshof zu.
Top Online Casinos für sicheres Spiel
Klicke auf eines der Bilder. Hier findest du eine komplette Übersicht.
Kernpunkt der Entscheidung: Die Verträge seien wegen Verstoßes gegen § 4 Abs. 4 des Glücksspielstaatsvertrags (GlüStV 2012) nichtig. Dieses ausdrückliche Internetverbot für öffentliche Glücksspiele war in Deutschland bis Juli 2021 in Kraft – und könne durch eine maltesische Lizenz nicht ausgehebelt werden.
„Eine Regelung, deren Wirksamkeit weder durch die EU-Dienstleistungsfreiheit noch durch eine maltesische Lizenz in Frage gestellt wurde“, so Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung.
Besonderheiten der Stuttgarter Entscheidung
- Deliktische Folgeansprüche: Das Gericht ließ den Kläger sogar Ansprüche aus unerlaubter Handlung (§ 852 BGB) geltend machen, um verjährte Phasen abzudecken.
- Verbraucherschutzprinzip: Schon die bloße jahrelange faktische Tätigkeit von Tipico rechtfertigt nicht, Verträge als wirksam anzusehen – „unabhängig davon, ob die Spieler von der Illegalität der Angebote Kenntnis hatten“.
- Internationale Zuständigkeit: Selbst mit Prozessfinanzierern im Hintergrund bleibt die deutsche Gerichtszuständigkeit gewahrt, da der Verbraucherstatus erhalten bleibt.
Kann Tipico in Deutschland zur Zahlung gezwungen werden?
Ja. Trotz maltesischer Lizenz unterliegen Anbieter, die ihr Angebot gezielt an deutsche Kunden richten, dem deutschen Glücksspielmonopol und den damit verbundenen Verbotsvorschriften.
Da die streitigen Spiele im relevanten Zeitraum in Deutschland illegal waren, gelten die Verträge als nichtig (§ 134 BGB), und verlorene Einsätze können zurückgefordert werden.
Das OLG Stuttgart bekräftigte, dass nationaler Spielerschutz ein „zwingendes Gemeinwohlziel“ darstellt, das europarechtlich nicht ausgehöhlt wird. Tipico wird die Verluste wohl zurückzahlen müssen.
Ähnliche Entscheidungen im Überblick
- Landgericht Hannover (5. Juni 2025): Rückzahlung von 21.827 € aus Online-Sportwetten bei Tipico, paralleles EuGH-Verfahren klärt die Vereinbarkeit mit der Dienstleistungsfreiheit.
- Landgericht Mönchengladbach (23. Dezember 2024): Erstattung von 23.928,50 € und vorgerichtlichen Anwaltskosten, da Tipico bis Oktober 2020 keine deutsche Lizenz besaß. Das Gericht betonte die hohe Schutzbedürftigkeit von Spielern und das erhebliche Suchtpotenzial.
- Landgericht Frankfurt am Main (9. September 2024): Verpflichtung zur Rückzahlung von 43.289,37 € nebst Zinsen, Urteil Az. 2‑13 O 50/24 bestätigt: Ausländische Lizenzen heben deutsches Verbotsrecht nicht auf.
Sind erwachsene Spieler für Verluste nicht selbst verantwortlich?
Kritiker werfen Spielern vor, sie wollten nun auf Kosten der Anbieter ihre eigenen, bewusst eingegangenen Verlustrisiken ausgleichen.
Tatsächlich tragen erwachsene Verbraucher grundsätzlich die Verantwortung für ihr Spielverhalten. Doch der Gesetzgeber hat bewusst einen starken Verbraucherschutz verankert, um besonders gefährdete Personen zu schützen und den rechtlichen Rahmen für Anbieter klar zu regeln.
Wie das OLG Stuttgart betonte, gilt der Schutz „unabhängig davon, ob die Spieler von der Illegalität der Angebote Kenntnis hatten“. Spieler können sich also darauf verlassen, dass sie nicht im Blaulicht unregulierter Angebote stranden.
Fazit
Die jüngsten Urteile markieren einen deutlichen Trend. Anbieter mit EU-Lizenz müssen sich an nationales Recht halten, wenn sie den deutschen Markt bedienen.
Für erwachsene Spieler öffnet sich die Tür, verlorene Einsätze nicht als eigenes Verschulden abzutun, sondern juristisch geltend zu machen.
Nicht zuletzt die anstehende BGH-Revision und das EuGH-Verfahren dürften das Thema bald höchstrichterlich klären – und werden mit Spannung erwartet.
Ob man als Spieler die Risiken allein tragen sollte oder ob die branchenweite Einhaltung strenger Lizenzanforderungen Vorrang hat, bleibt eine ethisch-rechtliche Frage.
Sicher ist jedoch: Solange nationale Verbote bestehen, erhalten die Gerichte die Option, Verbrauchern Rückendeckung zu geben – und für erwachsene Spieler, die sich zu Recht auf legales Gaming verlassen möchten, ist das eine willkommene Nachricht.
In Österreich ist die Judikative übrigens nicht derselben Meinung. Hier wurden Schadensersatzansprüche auch schon abgelehnt, und das mit Verweis auf … Eigenverantwortung.
Auch interessant
Du musst eingeloggt sein, um einen Kommentar zu posten.